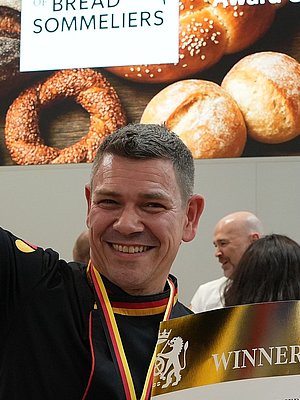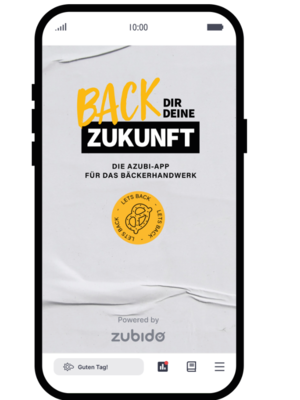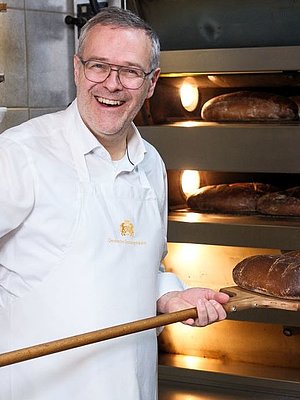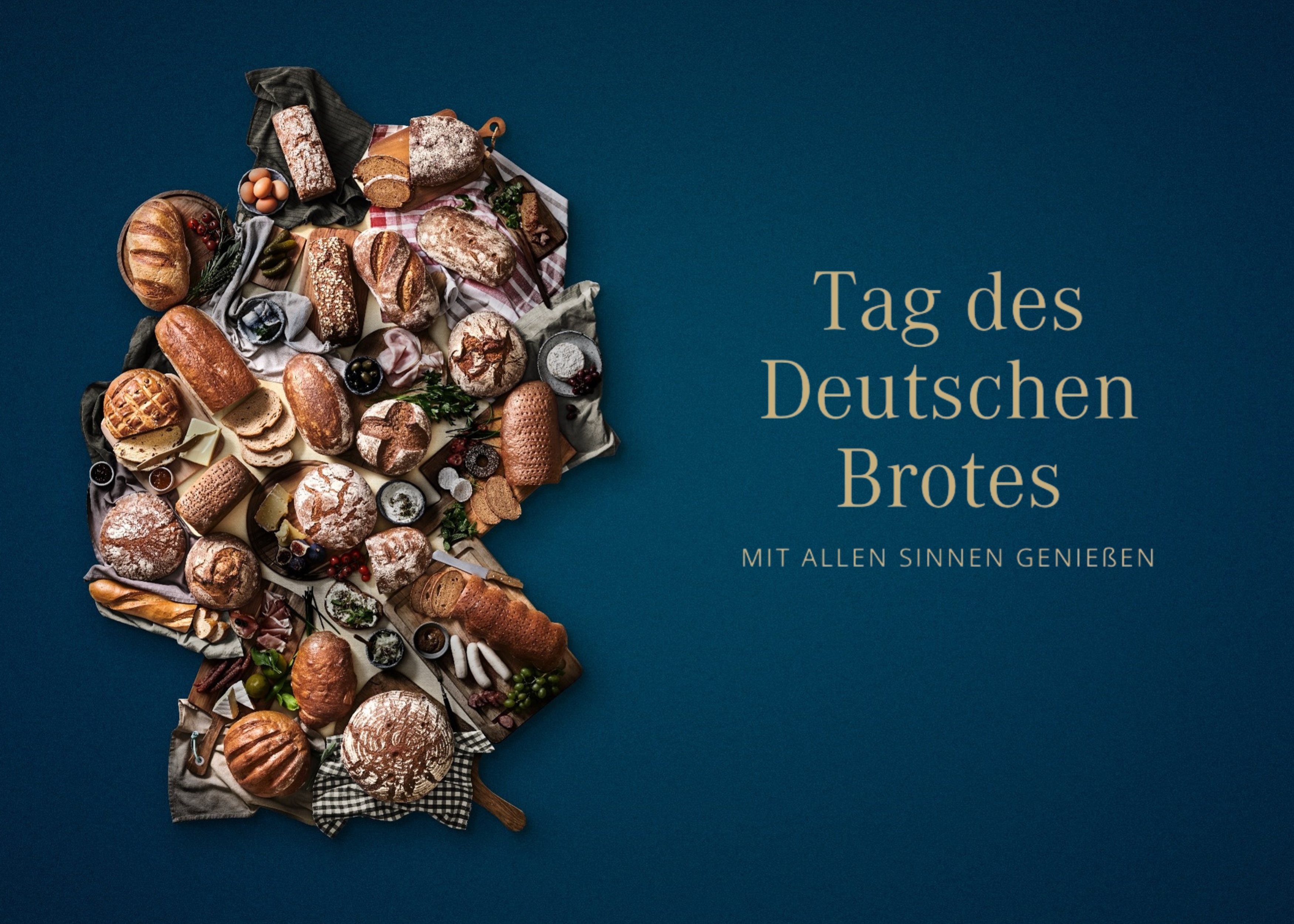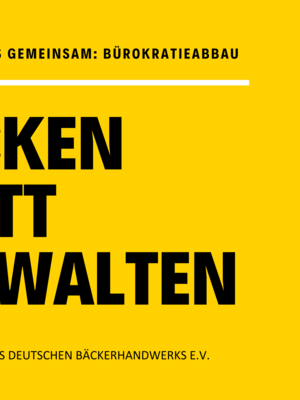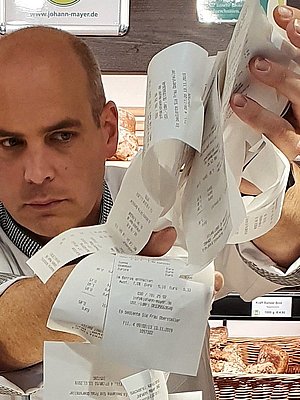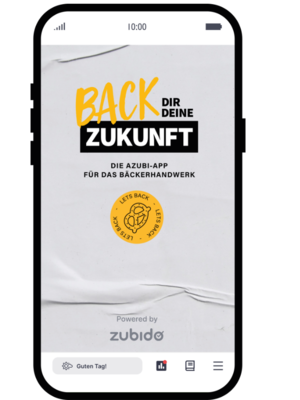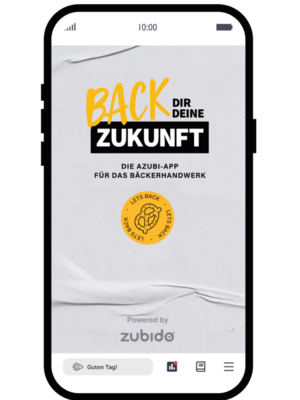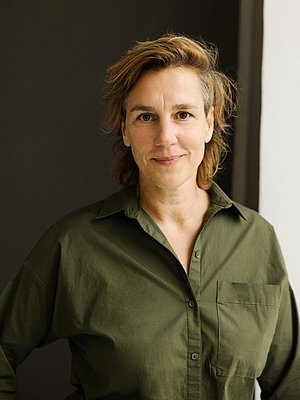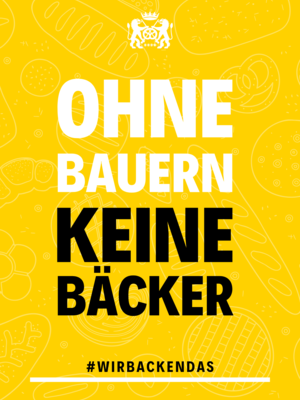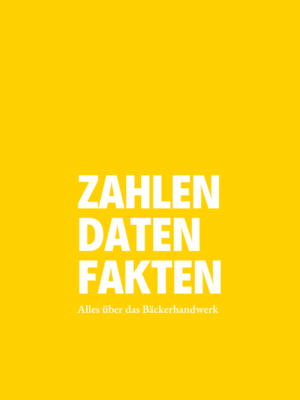Das Bundesverfassungsgericht hat am 15. November 2023 entschieden, dass das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 verfassungswidrig ist.
Die Entscheidung stürzte die Ampel-Koalition in eine Haushaltskrise: 60 Milliarden Euro mussten in der Konsequenz aus dem Klima- und Transformationsfonds gestrichen werden. Als Konsequenz rief die Bundesregierung zunächst eine Haushaltssperre aus und begann interne Beratungen über Umschichtungen und Kürzungen im Bundeshaushalt.
Der Zentralverband hat sich in dieser Situation schriftlich an die Bundesregierung gewandt und dringend appelliert, wichtige Entlastungen für die Wirtschaft wie die Strom- und Gaspreisbremse, die Dämpfung der Netzentgelte sowie die Reduzierung der Stromsteuer nicht anzutasten; die Bundesregierung solle dafür Sorge tragen, dass Bürger und Unternehmer in eine planungssichere Zeit blicken können.
Des Weiteren haben wir in einem Gespräch mit Bundesminister Özdemir gefordert, den Gesetzentwurf des geplanten Kinderlebensmittelwerbegesetzes in diesen herausfordernden Zeiten zu stoppen.
A. Übersicht der Sparbeschlüsse zum Bundeshaushalt 2024
Nach knapp vierwöchiger interner Beratung haben Bundeskanzler Scholz und die Bundesminister Lindner und Habeck erste Eckpunkte über einen überarbeiteten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr präsentiert. Dabei wurde Vieles lediglich umrissen und nur einige konkrete Maßnahmen angekündigt. Mittlerweile zeichnen sich jedoch weitere Punkte ab. Ein vollständiges Bild ergibt sich gegenwärtig allerdings noch nicht.
Nachfolgend stellen wir die derzeit bekannten Entwicklungen dar:
- Eckpunkte der Einigung
Nach den Plänen der Ampelregierung müssen im kommenden Jahr 17 Mrd. Euro im Bundeshaushalt eingespart werden. Die verfassungsrechtliche Schuldenbremse soll grundsätzlich nicht ausgesetzt werden. Die Haushaltslücke ist nach Regierungsangaben nicht vollständig aufgrund der Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zustande gekommen: 3 Milliarden seien durch die Senkung der Stromsteuer sowie weitere 6 Milliarden durch die Erhöhung des Bürgergeldes zu verbuchen gewesen.
Der Klima- und Transformationsfonds (KTF), aus dem in den kommenden Jahren große Klimaschutz- und Industrieförderprojekte finanziert werden sollten, wird neu aufgestellt. Im KTF sollen jedoch im Jahr 2024 12,7 Mrd. Euro eingespart werden. Bis 2027 verringern sich die geplanten Ausgaben des Fonds um insgesamt 45 Milliarden Euro. Sein Gesamtvolumen beträgt nunmehr 160 Milliarden Euro.
Derzeit offen ist noch die rechtliche Absicherung der Hilfsfinanzierung der Flutkatastrophe im Ahrtal. Diese wurden bisher ebenfalls aus einem Sondervermögen abgewickelt, das nach den Urteilsgrundsätzen neu aufzusetzen ist. Hierbei geht es um Hilfen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Insoweit wird erwogen, die verfassungsrechtliche Schuldenbremse für diesen eng umrissenen Teil für das Jahr 2024 noch einmal auszusetzen. Hierzu bedarf es der Zustimmung der Unionsparteien, mit denen kurzfristig gesprochen werden soll. Falls eine Einigung mit der CDU und CSU nicht zu erreichen ist, muss diese Summe zusätzlich im Kernhaushalt finanziert werden.
Bundeskanzler Scholz kündigte in der Pressekonferenz am 13. Dezember an, dass man für den Fall einer Verschlechterung der Lage in der Ukraine dem Bundestag einen "Überschreitungsbeschluss" vorlegen will. Für diesen Fall behält sich die Regierung demnach die Möglichkeit zur Erklärung einer Notlage im Sinne des Grundgesetzes vor, um dann die Schuldenbremse erneut aussetzen zu können.
Es wurde bei der Vorstellung der Pläne betont, dass die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Klimaneutralität, der soziale Zusammenhalt und die Unterstützung der Ukraine aus Sicht der Regierung weiterhin Priorität besitzen.
- Folgende handwerksrelevante Punkte sollen keine Kürzungen erfahren
- Die Streichung der EEG-Umlage beim Strom bleibt erhalten.
- Die Senkung der Stromsteuer für Unternehmen des produzierenden Gewerbes ab dem Jahr 2024 wird wie angekündigt umgesetzt (siehe zu den Einzelheiten unten im Abschnitt B.).
- Die beschlossenen Entlastungen bei der Einkommensteuer durch Anhebung der Freibeträge und Verschiebung der Tarifeckwerte („Abbau der kalten Progression") ab dem Jahr 2024 werden nicht rückgängig gemacht. Es werden keine Steuersatzerhöhungen erfolgen.
- Das Wachstumschancengesetz, dem der Bundesrat seine Zustimmung verweigert hat, soll aus Sicht der Bundesregierung weiterverfolgt werden. Damit bleiben wichtige Wachstumsimpulse weiterhin auf der Agenda; nach Äußerungen des Bundesfinanzministers im ursprünglichen Volumen von über 6 Mrd. Euro.
- Die Förderung beim Beschluss des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG): Damit ist die Unterstützung beim Heizungstausch auch weiterhin gesichert.
- Die Förderungen zum Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft sowie die Förderung der Halbleiterproduktion.
III. Bisher bekannte Sparmaßnahmen
Die Maßnahmen setzen sich aus der Erschließung neuer Einnahmen als auch aus Sparmaßnahmen zusammen:
1. Ausgabenkürzungen
Durch die Ausgabenkürzungen insbesondere beim KTF sind mehrere für das Handwerk wichtige Punkte betroffen:
- Der von der Bundesregierung zugesagte Zuschuss in Höhe von 5,5 Mrd. Euro zur Senkung der Netzentgelte beim Strom wird gestrichen. Damit steigen die Stromkosten sowohl für private als auch betriebliche Verbraucher. Die Netzentgelte werden von 3,12 Cent pro Kilowattstunde in diesem Jahr auf 6,43 Cent im nächsten Jahr steigen.
- Umfangreiche Streichungen der vor kurzem beim Baugipfel mit der Bauwirtschaft beschlossenen Ausweitungen bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Dazu gehören etwa die Aufstockungen beim Geschwindigkeitsbonus oder beim Sanierungsfördersatz.
- Auslaufen von Förderprogrammen: Der Umweltbonus für den Kauf von Elektrofahrzeugen ist bereits früher als geplant ausgelaufen.
- Weitere Förderprogramme werden gekürzt, so zum Beispiel das geplante Programm zum Aufbau von Transformationstechnologien, andere sollen erst gar nicht anlaufen. Details sind bisher unklar.
- Ferner werden Etatkürzungen für diverse Ministerien angekündigt, ohne dass diese bisher genauer beschrieben oder beziffert werden. Betroffen sind auch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
- Kürzung der Bundeszuschüsse für Regionalisierungsmittel um 0,35 Mrd. Euro.
- Soziales und Arbeitsmarkt: Kürzung der Ausgaben beim Wohngeld, Streichung des Bürgergeld-Bonus von 0,25 Mrd. Euro sowie Reduzierung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung um 0,6 Mrd. Euro (Beitragserhöhungen werden ebenso wie ein Absinken des Rentenniveaus von 48 % ausgeschlossen). Ferner wird der Bundesagentur für Arbeit ein Konsolidierungsbeitrag von zunächst pauschal 1,5 Mrd. Euro in 2024 auferlegt, der aus Beitragsmitteln zu finanzieren ist. Dabei wird der Beitragssatz garantiert.
2. Abbau von Steuer-Subventionen
Wie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, werden sogenannte klimaschädliche Subventionen abgebaut. Bisher sind die folgenden Punkte bekannt:
- Streichung der Steuerbegünstigungen für Landwirte beim sogenannten „Agrardiesel“;
- Streichung der Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Forst- und Landwirtschaft;
- Besteuerung von Kerosin für den nationalen Flugverkehr;
- Streichung des Absenkungsmechanismus bei der Luftverkehrsabgabe.
IV. Erhöhung von Einnahmen des Bundes
- Der CO2-Preis wird im Jahr 2024 auf 45 Euro pro Tonne CO2 (statt wie geplant auf 40 Euro) angehoben. Der CO2-Preis betrifft fossile Brennstoffe für die Sektoren Wärme und Verkehr, also beispielsweise Gas, Heizöl sowie Diesel und Benzin. Damit wird der CO2-Preis wieder auf das bereits von der Großen Koalition beschlossene Niveau angehoben. Auch für die Folgejahre wird der Preis nach der ursprünglichen Planung steigen. Damit werden voraussichtlich die Preise für Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl steigen. Experten schätzen die Preissteigerung bei einem Liter Diesel auf rund 4,8 Cent/l gegenüber dem heutigen Preis und bei einem Liter Benzin auf rund 4,2 Cent/l gegenüber dem heutigen Preis. Bei Erdgas steigen die Kosten voraussichtlich um 0,36 Cent pro Kilowattstunde.
- Seit 2021 existiert eine sogenannte EU-Plastikabgabe. Bisher wurde die Summe in Höhe von 1,4 Mrd. Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Diese wird auf die Menge der nicht recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff erhoben und fließt in den EU-Haushalt. Zukünftig sollen die Verbraucher diese unmittelbar entrichten. Diese EU-Plastikabgabe ist nicht mit der am 2. März 2023 verabschiedeten Sonderabgabe für Produkte aus Einwegplastik zu verwechseln. Damit dürfte eine Erhöhung von Bürokratie für den Handel und das Bäckerhandwerk einhergehen.
- Die geplanten Investitionen in die Schieneninfrastruktur von rund 13 Milliarden Euro im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027 werden nicht mehr über den KTF finanziert. Stattdessen wird in Aussicht gestellt, Bundesbeteiligungen zu privatisieren und die Erlöse der Deutschen Bahn als Eigenkapital zur Verfügung zu stellen.
V. Weiterer Zeitplan
Über den Zeitplan zur parlamentarischen Beratung des geänderten Haushalts 2024 wurden von den Spitzen der Regierungskoalition keine genauen Angaben gemacht. Eine erste Befassung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages könnte - eine schnelle Konkretisierung der Pläne durch die zuständigen Bundesministerien vorausgesetzt - noch vor Weihnachten erfolgen.
Die ersten parlamentarischen Beratungen sind voraussichtlich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im Jahr 2024 (3. Kalenderwoche) zu erwarten. Wir rechnen mit einem Inkrafttreten Anfang Februar 2024.
Bis zur endgültigen Verabschiedung gelten die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung nach dem Grundgesetz.
VI. Bewertung aus Sicht des Zentralverbandes
Aufgrund der noch nicht vollständigen Informationen ist eine abschließende Bewertung des vorliegenden Pakets derzeit nur bedingt möglich.
Zunächst einmal ist die Einigung der Ampelkoalition eine gute Nachricht: Die „Hängepartie" der vergangenen Wochen wurde noch vor Weihnachten beendet. Alle drei Beteiligten der Regierungskoalition zeigen Kompromissbereitschaft und dokumentieren Handlungsfähigkeit. Dies ist ein wichtiges Signal.
Aber: Nachhaltige Strukturreformen wurden erneut vertagt. Aufgrund der vielen ungeklärten Details verbleibt für die Handwerksbetriebe weiterhin eine hohe Unsicherheit.
Deutlich wird schon jetzt, dass es auch für Handwerksbetriebe zu Kostensteigerungen kommen wird.
Insbesondere die steigenden Energiekosten sind für das Handwerk höchst problematisch. Der hohe CO2-Preis wird alle Betriebe des Handwerks treffen und negativ beeinflussen. Aufgrund der zum Teil gegenläufigen Maßnahmen (wie steigender CO2-Preis und Absenkung der Stromsteuer) ist jedoch eine genaue Abschätzung der letztendlichen finanziellen Auswirkungen schwierig.
Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland wird durch die geplanten Maßnahmen in jedem Fall geschwächt, da es keinen europäisch oder international abgestimmten Klimaschutz gibt.
Im Bereich der Gebäude (-sanierung) sind die erheblichen Einschnitte besonders kritisch und werden diesen Sektor belasten. Dies ist angesichts der schwierigen Lage am Bau nicht nachvollziehbar.
Kritisch sind aus Sicht des lohnintensiven Handwerks auch die geplanten Kürzungen bei den Bundeszuschüssen an die Sozialkassen zu bewerten. Nach uns vorliegenden Informationen sollen die Konsolidierungsbeiträge der Bundesagentur für Arbeit und der Rentenkassen nicht nur einmaliger Natur sein, sondern sollen jährlich für einen Zeitraum bis ins Jahr 2027 zu erbringen sein. Damit könnte bei einem mäßigem Konjunkturverlauf die Stabilität der Sozialversicherungsbeiträge akut gefährdet werden.
Vorsichtig positiv kann das Bekenntnis der Bundesregierung gewertet werden, bei zentralen Maßnahmen des klimagerechten Umbaus der deutschen Wirtschaft eingegangene Zusagen einzuhalten.
Ebenfalls positiv aus Sicht des Handwerks ist der Verzicht auf Erhöhungen bei der Ertragsbesteuerung sowie die Umsetzung des Abbaus der kalten Progression. Das noch nicht beschlossene Wachstumschancengesetz mit den darin angekündigten steuerlichen Wachstumsimpulsen muss nun zügig in einem Vermittlungsausschuss beraten und eine Einigung mit den Ländern erzielt werden. Der angekündigte Abbau von Steuersubventionen trifft das Handwerk nicht unmittelbar.
Insbesondere die nicht näher beschriebenen Etat-Kürzungen bei mehreren Ministerien könnten zu weiteren Einschnitten auch für die Handwerksorganisation selbst führen. Hier muss eine Konkretisierung abgewartet werden.
Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks
B. Senkung der Stromsteuer für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ab dem Jahr 2024
Die Ampel-Koalition hat auf Eckpunkte des Haushalts 2024 nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verständigt. Bestandteil der Einigung ist das Beibehalten der geplanten Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß. Die Senkung wird wie geplant zum 1. Januar2024 in Kraft treten.
Die Finanzierung der allgemeinen Stromsteuersenkung wird aus dem Kernhaushalt des Bundes finanziert.
I. Im Einzelnen
Aktuell beträgt die Stromsteuer etwa 1,54 Cent pro Kilowattstunde. Nun soll sie auf den europäischen Mindestsatz von 0,05 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden. Dies bedeutet eine Entlastung von etwa 1,49 Cent pro Kilowattstunde für alle Unternehmen des Produzierenden Gewerbes.
Die Zuordnung der einzelnen Branchen zum Produzierenden Gewerbe erfolgt nach der Klassifizierung der Wirtschaftszweige (WZ-Schlüssel) in der Fassung von 2003 (§ 2 Nr. 3 StromStG). Das Produzierende Gewerbe ist in den WZ-Schlüsseln 10 bis 45 aufgezählt. Letztlich ist es immer im Einzelfall zu prüfen, ob und inwieweit ein Betrieb zum produzierenden Gewerbe zählt oder nicht.
Handwerksbäckereien sind nach Auffassung des Zentralverbandes Unternehmen des "Produzierenden Gewerbes" und können damit von der Absenkung der Stromsteuer profitieren, wenn sie eine eigene Herstellung von Backwaren und/oder Konditorwaren haben, was bei den meisten Betrieben der Fall ist. Unklar ist noch, ob für die Betriebe in der Folge als Ganzes die Stromsteuer gesenkt wird oder nur für die Backstuben, nicht aber für die Verkaufsstellen.
Die Absenkung der Stromsteuer gilt zunächst für die Jahre 2024 und 2025. Sie soll für weitere drei Jahre verlängert werden, sofern für die Jahre 2026 bis 2028 eine Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt dargestellt werden kann.
Nach Auffassung der Bundesregierung soll die nun beschlossene Absenkung der Stromsteuer den Zeitraum von etwa fünf Jahren überbrücken. Danach sollen die Quellen der erneuerbaren Energien (insbesondere Sonnen- und Windenergie) besser ausgebaut sein, was nach Ansicht der Bundesregierung ein Sinken des Strompreises zur Folge haben soll.
Durch die Absenkung der Stromsteuer auf den EU-Mindeststeuersatz wird die regulär zum 31. Dezember 2023 auslaufende Steuerentlastung in Sonderfällen nach § 10 StromStG (sogenannter Spitzenausgleich) gestrichen.
Neben der Senkung der Stromsteuer für alle Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sind darüber hinaus für besonders energieintensive Unternehmen weitere Maßnahmen geplant. Diese dürften jedoch nur großen Industrieunternehmen zugutekommen.
1. Verfahren
Begünstigte Betriebe des Produzierenden Gewerbes erhalten die Stromsteuerermäßigung ausschließlich auf Antrag. Die Stromrechnung muss also zunächst im vollen Umfang bezahlt werden. Begünstigte Unternehmen müssen einen Antrag auf Erstattung nach § 17b Abs. 1 Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV) beim jeweils zuständigen Hauptzollamt stellen. Dieser ist grundsätzlich nach § 17b Abs. 1 StromStV bis spätestens zum 31. Dezember des folgenden Kalenderjahres einzureichen.
Dabei ist zu beachten, dass für die Entlastung ein Sockelbetrag von 250 Euro gilt, das heißt eine Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der Entlastungsbetrag 250 Euro übersteigt. Weitere Details zum Verfahren sind noch nicht bekannt.
2. Bewertung aus Sicht des Zentralverbandes
Die jetzt beschlossene Senkung der Stromsteuer ist grundsätzlich positiv zu bewerten und setzt die von uns gemeinsam mit dem ZDH vorgetragene Forderung um, dass eine Entlastung bei den Stromkosten allen Unternehmen, und nicht nur einzelnen Branchen, zugutekommen muss.
Unser Zentralverband hatte in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem ZDH immer wieder für eine Entlastung der gesamten Wirtschaft geworben und dabei betont, dass die Industrie nicht bevorzugt werden darf.
Allerdings ist die Beschränkung auf „Unternehmen des Produzierenden Gewerbes" bei der Senkung der Stromsteuer aus Sicht des Handwerks unzureichend, da es zahlreiche energieintensive Gewerke mit Dienstleistungscharakter wie beispielsweise Textilreiniger, Friseure und Teile des Kfz-Handwerks von der Begünstigung ausschließt.
Bedauerlich ist zudem, dass entgegen den Ausführungen in der Gesetzesbegründung („Hierdurch wird eine bürokratiearme Entlastungsmöglichkeit geschaffen.") die Erstattung der Stromsteuer nur aufgrund eines Antrages erfolgt und zu erheblicher Bürokratie und Kosten für die begünstigten Unternehmen führen wird.
Die verkündeten Sparmaßnahmen für das Jahr 2024 sehen zudem leider Verteuerungen auch des Stroms vor. Insoweit wird die Steuersenkung den Kostendruck für Betriebe im Bereich der Energie durch die sprunghafte Erhöhung des CO2-Preises sowie die weiter erhobenen Netzentgelte häufig nicht ausgleichen können.
IV. Aktueller Stand
Am 15. Dezember hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung das Gesetz verabschiedet. Der Gesetzentwurf hat den Bundesrat ebenfalls passiert. Die offizielle Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt ist in Kürze zu erwarten.
Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks
C. Änderung beim Mindestlohn und Minijob-Verdienstgrenze zum 1. Januar 2024
Wir möchten Sie vorsorglich nochmals auf folgende wichtige Veränderungen zum neuen Jahr aufmerksam machen:
I. Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns: Zum 1. Januar 2024 wird der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 12 Euro auf 12,41 Euro brutto je Stunde angehoben.
In einem zweiten Schritt erfolgt zum 1. Januar 2025 eine weitere Aufstockung des Mindestlohns auf 12,82 Euro brutto je Stunde.
II. Höhere Verdienst-Obergrenze bei Minijobs: Zudem wird zum 1. Januar 2024 auch die Verdienstgrenze für Minijobs von aktuell 520 Euro auf 538 Euro angehoben.
III. Auswirkung auf Midi-Jobs: Die Verdienstobergrenze für Midi-Jobs wird nicht erhöht und verbleibt bei 2.000 Euro. Sie sollten allerdings beachten, dass mit der neuen Minijob Verdienstobergrenze von 538 Euro folglich die untere Lohngrenze für Midi-Jobs ab dem 1. Januar 2024 nun auf 538,01 Euro ansteigt.
Stand: 20. Dezember 2023